Forscher, Brückenbauer, Volksheld: Nachruf auf Werner Daum
Er öffnete das Tor der Botschaft in Tirana für Flüchtlinge, enthüllte die Bombardierung eines Pharmawerks in Khartoum und lud Leni Riefenstahl in den Sudan ein. Der Diplomat Werner Daum machte Politik ohne sich dabei immer ganz genau an die Anweisungen seines Dienstherren zu halten.
Die Sozialistische Volksrepublik Albanien war das letzte Land, zu dem Westdeutschland diplomatische Beziehungen aufnahm. Und Werner Daum war dessen erster Vertreter in Tirana, der 1987 in seinem Hotel die erste Bonner Mission in dem kommunistischen Land eröffnete.
Daum wollte zum Sturz des Regimes beitragen. «Entgegen der Anweisungen des Ministers Hans-Dietrich Genscher öffnete ich das Tor der Botschaft. Ich rechnete fest damit: Das Regime wird die Bilder von den Flüchtlingen in der Botschaft nicht überleben», erinnerte sich Daum im persönlichen Gespräch in seiner Berliner Wohnung, die mehr einer Bibliothek glich. Tatsächlich gingen die TV-Bilder der 3.199 Albaner im Garten der Botschaft um die Welt. Daum gewährte ihnen politisches Asyl und versorgte sie neun Tage lang mit Wasser und Lebensmitteln bis er ihnen in Bussen die Ausreise nach Deutschland ermöglichte. Ein in der Botschaft geborenes Baby wurde von der Mutter aus Dankbarkeit «Germania» genannt.
Daum hatte die Botschaft nicht nur aus humanitären, sondern vor allem aus politischen Gründen geöffnet, weil er die stalinistische Diktatur beenden wollte. Bis heute feiern die Albaner ihn dafür als Volkshelden, nennen ihn den «Botschafter der Freiheit». Präsident Bujar Nishani ehrte ihn 2012 für seinen Beitrag zum Regime Change mit dem Verdienstorden Naim Frashëri. Und der Bürgermeister von Kavajë, der Stadt des ersten antikommunistischen Aufstands 1990, ehrte Daum am Tag vor seinem Tod noch einmal dafür.
Als er am 12. Juli zwei Tage vor seinem 82. Geburtstag in Kavajë starb, trauerte ein ganzes Land um ihn. Blendi Fevziu, Moderator der Sendung «Opinion» bei Klan TV, der Daum kurz vor seinem Tod interviewte, sagt: «Er hat für das Wichtigste gekämpft, das es gibt: für unsere Freiheit!»
Als Daum Botschafter im Sudan war, bombardierten die US-Streitkräfte am 20. August 1998 das Shifa-Pharmawerk in Khartoum. Daum berichtete dem Amt noch am selben Tag, wie «amerikanische Flugzeuge» auf die Fabrik «ca. fünf Raketen» abgefeuert hätten. Nach offiziellen Angaben der US-Regierung aber hatten unbemannte Marschflugkörper das Werk zerstört. Die US-Regierung behauptete außerdem, in der Arzneimittelfabrik sei eine chemische Substanz für Nervengas hergestellt worden.
Daum hingegen berichtete nach Bonn: «Man kann die Firma Shifa beim besten Willen nicht als chemische Fabrik bezeichnen, da die Rohstoffe für die Arzneimittel sämtlich aus China und Europa importiert werden.» Produktionsstätten und Büros seien «an keiner einzigen Stelle irgendwie abgeschirmt oder geheimgehalten. Täglich besuchten zahlreiche Apotheker, Vertreter und andere die Firma.»
Außenminister Klaus Kinkel teilte die Darstellung der US-Administration. Daums Report wurde «im AA und im Verteidigungsministerium gezielt niedergeredet: Es handele sich nicht um seriöse Berichterstattung, sondern um subjektive Eindrücke, bar jeder Sachkenntnis, um Hörensagen und Märchen», schrieb DER SPIEGEL. Dennoch ging Daum der Sache eigenmächtig weiter nach und berichtete nach weiteren Recherchen vor Ort, der langfristige Ausfall von Arzneimitteln aufgrund der Bombardierung des Pharmawerks habe möglicherweise «Zehntausende Zivilisten» das Leben gekostet.
Im Februar 2000 lud Daum die 97-jährige Leni Riefenstahl in den Sudan ein, «obwohl Joschka Fischer total dagegen war. Doch wenn ich von etwas überzeugt war, dann tat ich es auch, allen Widerständen aus dem Amt zum Trotz», erzählte Daum, der Riefenstahl ihren letzten Wunsch erfüllen wollte, vor ihrem Tode noch einmal in den Sudan zu reisen: Nuba sehen und sterben. Der unerwünschte Gast, den Daum heimlich in seiner Residenz empfangen mußte, stürzte mit dem Helikopter über El Obeid ab. Die Rotorblätter des auf die Seite gefallenen Hubschraubers brachen in Form eines Hakenkreuzes.
Das Amt war verärgert über Daums aufmüpfige Einladung an Riefenstahl, die den Absturz mit zwei gebrochenen Rippen schwer verletzt überlebte, und degradierte ihn zum Vize-Botschafter unter Wolfgang Ischinger in London.
Vor der Versetzung nach London verabschiedete Daum sich in Khartoum vom religiösen Führer Hassan al-Turabi. Sudan-Analyst Roman Deckert begleitete ihn und erinnert sich: «Daum überreichte al-Turabi als Geschenk ein Buch, über das er meinte, es enthalte neuste wissenschaftliche Erkenntnisse, die bewiesen, daß das meiste, was in der Bibel stehe, schlichtweg erfunden sei. Das würde dem Islam in den nächsten Jahrzehnten ähnlich ergehen. Ich musste schlucken und dachte, oje, Turabis Leute sind doch Hardcore-Islamisten, hoffentlich schneiden die uns nicht die Kehlen durch. Stattdessen meinte Turabi zu Daum, daß dieser Recht habe. Und apropos: Der Koran sei ja von Juden aufgeschrieben worden, weil es damals die einzigen waren, die schreiben konnten.»
Daum war gläubiger Katholik, der regelmäßig in die Kirche ging. Ostern 2021 schmerzte ihn sehr, daß der Gottesdienst in Berlin verboten war. Während der Corona-Maßnahmen durfte er seine Frau nicht mehr im Altenheim besuchen, die dort einsam starb. Er hatte tiefe Kenntnisse vom Islam, hielt sich in islamischen Ländern an den Ramadan und fastete mit.
Während Daum im Jemen stationiert war, wollte er seine Kenntnisse vom glücklichen Arabien in Form einer Ausstellung nach Deutschland bringen. Walter Raunig (89), Direktor des Staatlichen Museums für Völkerkunde in München, und sein Kurator Wolfgang Stein (72), verwirklichten mit Daum dessen ambitioniertes Projekt.
Der Fotojournalist Hermann Dornhege begleitete Daum bei seinen Einkäufen für die Ausstellung auf den Souk al-Milh in Sanaa: «Daum war im Jemen immer im Anzug, mit Krawatte und Aktentasche unterwegs. Mit einer Schubkarre zog er große Geldstapel durch den Souk, weil das Geld für den Schmuck nicht mehr in seine Aktentasche passte. Der Händler stapelte das ganze Geld die Wand hoch bis zur Decke.»
Das Museum Fünf Kontinente schreibt über die von Daum initiierte Jemen-Ausstellung, sie «ist auch nach Jahrzehnten untrennbar mit unserem Haus verbunden und der begleitende Katalog gilt bis heute als Standardwerk zur jemenitischen Kunst und Kultur. Seine Sammlung, insbesondere der jemenitische Schmuck, ist inzwischen Teil des Museums und ermöglicht zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern intensive Forschung und neue Erkenntnisse.»
Besucher sprechen Mitarbeiter des Museums bis heute auf Daums Jemen-Ausstellung an, die 1987 über 400.000 Besucher zählte. Daß Menschen fast vierzig Jahre später noch immer begeistert von einer Ausstellung und dem begleitenden Katalog erzählen, ist selten in der Museumswelt.
Daum sammelte nicht nur Schmuck, sondern auch Geschichten. Sein Buch «Märchen aus dem Jemen» ist ein Meisterwerk. Als er vor ein paar Jahren in Berlin einen Vortrag über den Jemen hielt, war der große Saal überfüllt und Leute hörten durch geöffnete Fenster von draußen zu.
Asfa-Wossen Asserate (76), Vorsitzender der Orbis Aethiopicus Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung der äthiopischen Kultur, schätzt Daums Buch «Die Königin von Saba. Kunst, Legende und Archäologie zwischen Morgenland und Abendland» und vermißt ihn sehr: «Er war ein Universalgelehrter sondergleichen, ein Brückenbauer zwischen Ost und West. Er war offen für die Ideen der neuen Generation. Er war bereit, alles in Frage zu stellen, auch seine eigenen Thesen. Mit welcher Inbrunst er mit jungen Menschen auf unserer letzten Tagung in Gotha diskutierte, das finden Sie heute in den seltensten Fällen.»
Daum forschte nicht nur zu Abessinien, sondern auch über ursemitische Religion, den vorislamischen Jemen und den antiken Sudan. Er beauftragte Jemeniten im Kriegsgebiet, ihm Fotos von Inschriften zu schicken, von Orten, an die kein Ausländer vordringen kann. Er förderte junge Historiker wie Mohammed Awadh Atbuosh, dem er zu einem Stipendium der Gerda Henkel Stiftung und zu einem Visum für Deutschland verhalf, das Atbuosh vor dem Krieg im Jemen rettete.
Daum entwickelte eine tiefe Zuneigung zur Bevölkerung des Landes, in dem er stationiert war. Er sprach fließend deren Sprache, ging allein spazieren, kaufte selber ein und sprach mit jedem, dem Blumenhändler, dem Erdbeerverkäufer und dem Schuhputzer. Deshalb müssen Diplomaten auch immer rasch ihre Einsatzorte wechseln, damit keine Verbrüderung geschieht.
Doch auch nach seinen Versetzungen hielt Daum die enge Verbindungen, die er zu Menschen in den Ländern aufbaute, in denen er stationiert war und pflegte sie intensiv durch regelmäßige Korrespondenzen in vielen Sprachen. Deshalb sind nicht nur Albaner von Daums Tod erschüttert, sondern auch Sudanesen und Jemeniten, die ihn mit Nachrufen würdigten, obwohl er vor Jahrzehnten dort diente.
Daum war ein undiplomatischer Diplomat, der nichts kaschierte und die Realität schonungslos beschrieb. Das mißfiel seinen Dienstherren im Amt. Doch scherte er sich nicht um seine Reputation im Amt. Er begegnete lieber den Menschen auf Augenhöhe, anstatt sich für eine Karriere im Amt ins Zeug zu legen. Daum diente dem Menschen, nicht dem Amt.
Klicken Sie auf das Foto, um zur Fotostrecke zu gelangen:
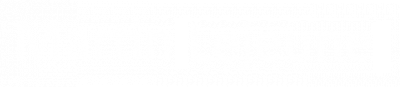






Mi mancherai,splendido e meraviglioso , non ti dimenticherò mai,grazie